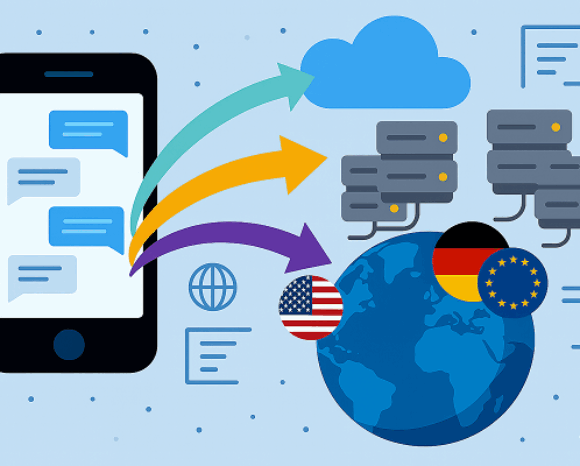Wie ein Cyber Exit Room zur gelebten Sicherheitskultur beiträgt – ein Erfahrungsbericht: Erleben statt nur verstehen
Wie gelingt es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter emotional und nachhaltig für Informationssicherheit zu sensibilisieren? Und wie lassen sich bestehende Richtlinien so vermitteln, dass sie nicht nur gelesen, sondern auch verstanden und gelebt werden? Unser Autor stellt ein interaktives Awareness-Format aus dem Projektalltag vor und leitet daraus praxisnahe Handlungsempfehlungen für die Gestaltung eigener Kampagnen ab.

Awareness-Maßnahmen gehören zum festen Bestandteil jeder ganzheitlichen Sicherheitsstrategie. Doch allzu oft werden sie zur reinen Pflichtübung degradiert. Das Resultat: geringe Wirksamkeit, kaum Erinnerungswert. Es sind nicht nur Konzepte und Richtlinien, die Informationssicherheit im Unternehmen tragen, sondern die Mitarbeiter selbst – von der Geschäftsführung bis hin zur operativen Arbeitsebene – durch ihr tägliches Handeln, ihre Aufmerksamkeit, ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.
Trotzdem wird Awareness vielerorts als notwendiges Übel behandelt. Externe Schulung beauftragt? Haken dran. Teilnahme bestätigt? Haken dran. Aber wenn man später nachfragt, bleibt oft nicht viel hängen. Das Erlebte war kaum mehr als ein Programmpunkt – aber kein Impuls, kein Aha-Moment.
Emotionen gehören zur Awareness
Dabei gibt es sie, die positiven Beispiele. Dort, wo Verantwortliche verstanden haben, dass Bewusstsein für Sicherheit nicht nur Wissen
bedeutet, sondern Können – und Wollen. Ein solcher Fall war Teil eines Projekts in einem großen mittelständischen Unternehmen und zeigt, wie Sicherheitskultur tatsächlich gelebt werden kann. Im Projektumfeld trafen mehrere regulatorische Vorgaben aufeinander – eine klassische Multi-Compliance-Herausforderung, die eine koordinierte Umsetzung verschiedenster gesetzlicher Anforderungen verlangte.
Mitten in diesem Umfeld stellte sich eine einfache Frage: „Warum weiß eigentlich niemand im Haus, was wir hier machen?“ Dahinter steckte mehr als ein Kommunikationsproblem. Begriffe wie „ISMS“, „Audit“ oder „Zertifizierung“ erzeugen bei vielen eine unbewusste Abwehrhaltung. Das Wort allein löst bereits Unbehagen aus. Ein klassischer Nocebo-Effekt, er greift dort, wo Begriffe nicht erklären, sondern einschüchtern. Nicht die Information selbst erzeugt Unsicherheit, sondern die Vorstellung, ihr nicht gewachsen zu sein – und damit beginnt der Verlust von Handlungskompetenz.
Cyber Exit Room
Doch aus dieser Beobachtung entstand eine Idee: Warum das, was im Hintergrund läuft, nicht sichtbar, begreifbar und erlebbar machen? Kein PowerPoint. Kein Pflichtmodul. Sondern ein Erlebnis. Im Rahmen einer unternehmensweiten „Discovery Tour“ entstand so ein Format, das das Sicherheitsteam in den Mittelpunkt stellte – mit einem Cyber Exit Room.
Die Büros der Sicherheitsabteilung wurden dafür zu Lernräumen, oder besser gesagt, Erlebnisräumen, umgestaltet. Dort inszenierte das Sicherheitsteam typische Verstöße gegen die Clear Desk und Clear Screen Policy und andere Alltagsrisiken – ungesperrte Bildschirme, herumliegende Passwörter auf Post-its, verlassene USB-Sticks, RSA-Token oder Transponder-Schlüssel – achtlos neben dem Kaffee abgestellt.

Im Cyber Exit Room müssen Teilnehmer die versteckten Fehler im Bereich Clear Desk und Screen entdecken.
Nicht zu vergessen: das unscheinbare Amazon-Ventilator-Gadget mit Bluetooth, das ohne Weiteres und fröhlich ans Netzwerk angeschlossen wird. Die Teilnehmer betraten den Raum, erhielten eine kurze Einführung – und suchten dann gemeinsam nach Fehlern, erklärten ihre Relevanz und diskutierten über mögliche Konsequenzen.
Die Idee war einfach, die Wirkung groß. Der Raum wurde zur Bühne für Auseinandersetzung, für Neugier, für kleine Wettkämpfe. Wer die meisten Verstöße fand, bekam symbolisch Punkte. Es wurde gelacht, diskutiert, gelernt. Feedback wie „endlich mal was zum Anfassen“ oder „jetzt verstehe ich, warum das wichtig ist“ bestätigten: Hier wurde nicht geschult, sondern erlebt.
Warum das funktioniert? Weil Menschen durch Neugier lernen. Nicht durch abstrakte Inhalte, sondern durch Ausprobieren. Genau wie beim Laufenlernen, beim ersten Smartphone oder beim Fahrradfahren. Der Impuls kommt aus uns selbst – weil wir verstehen wollen. Weil wir entdecken wollen.
Heute nennen wir das Awareness. Im Kern ist es dieselbe Kraft. Die Neugier als Motor des Lernens. Und genau das machen Formate wie Cyber Exit Rooms sichtbar. Sie nutzen diese Motivation, schaffen Raum für echte Auseinandersetzung und stärken die Sicherheitskultur nachhaltig.
Für Organisationen, die bislang auf klassische Formate setzen, kann das ein nachhaltiger und kostengünstiger Impuls sein. Für andere, die bereits viele digitale Kampagnen umgesetzt haben, ein Anlass zur Reflexion. Vielleicht ist es an der Zeit, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen – und Sicherheit nicht nur zu erklären, sondern erlebbar zu machen.

Tabelle: Awareness-Kampagnen-Planungstemplate
Vom Erlebnis zur Methode
Wie aber lässt sich ein solches erlebnisorientiertes Format – exemplarisch der Cyber Exit Room – konkret realisieren? An dieser Stelle wechseln wir von der erzählenden Perspektive zur methodischen Betrachtung: Es geht nun darum, wie ein Awareness-Format systematisch konzipiert, durchgeführt und evaluiert werden kann. Die folgenden Schritte orientieren sich an bewährten Prinzipien des Awareness-Managements, der Projektplanung und kontinuierlicher Verbesserung.
Die beschriebenen Maßnahmen sind anschlussfähig an etablierte Informationssicherheitsstandards (zum Beispiel ISO/IEC 27001, NIST CSF oder auch BSI IT-Grundschutz) und können in verschiedene Unternehmenskontexte eingebettet werden.
Zielklärung und strategische Einbettung:
Jede Awareness-Kampagne beginnt mit der klaren Definition des angestrebten Zielzustands. Soll ein konkretes Verhalten verändert, ein bestimmtes Risiko adressiert oder ein unternehmensweites Verständnis aufgebaut werden? Diese Zielsetzung muss sowohl auf Management- als auch auf Mitarbeiterebene anschlussfähig sein.
Thematische Fokussierung und Zielgruppenbezug:
Die Auswahl des inhaltlichen Schwerpunkts einer Awareness-Kampagne erfolgt auf Basis des identifizierten Risikos, der unternehmensinternen Relevanz sowie der Anschlussfähigkeit an bestehende Initiativen. Dabei sollten Themen bevorzugt werden, die ein hohes Maß an Alltagstauglichkeit aufweisen und gleichzeitig als repräsentativ für übergeordnete Schutzziele fungieren. Klassische Themenfelder wie Passwortsicherheit, Clear Desk Policy oder physischer Zugangsschutz bieten sich hier besonders an, da sie sowohl visuell als auch inhaltlich gut inszenierbar sind.
Interdisziplinäre Einbindung relevanter Stakeholder:
Eine wirksame Awareness-Kampagne entsteht nicht im Alleingang der IT- oder IT-Sicherheitsabteilung. Vielmehr erfordert sie die frühzeitige Einbindung relevanter Funktionen: Kommunikation, Personalentwicklung, Datenschutz, Facility-Management und nicht zuletzt das Topmanagement. Diese Schnittstellen bestimmen maßgeblich die Akzeptanz, die Sichtbarkeit und die Anschlussfähigkeit der Kampagne innerhalb der Organisation.
Kontextuelle Rahmensetzung und Raumgestaltung:
Die Umsetzung sollte nicht in abstrakten Formaten erfolgen, sondern räumlich und atmosphärisch eingebettet werden – dort, wo Menschen tatsächlich arbeiten. Realitätsnahe Szenarien und physisch begehbare Stationen erhöhen die Identifikation und schaffen multisensorische Lernsituationen, die nachweislich eine höhere Gedächtniswirkung entfalten. Dies kann ein realer Bürobereich, ein Empfangsbereich oder ein leer stehender Besprechungsraum sein.
Didaktische Aufbereitung und visuelle Kommunikation:
Die visuelle und didaktische Gestaltung der Inhalte orientiert sich an Prinzipien des Micro-Learnings, der kognitiven Entlastung und des emotionalen Storytellings. Absichtlich platzierte Verstöße (etwa ein Post-it mit Passwort) dienen nicht der Bloßstellung, sondern als Katalysator für Gespräche, Reflexion und Selbstkorrektur. Der Einsatz klarer visueller Marker, Farbkontraste und narrativer Elemente sind dabei essenziell.
Moderation als Kommunikationsinstrument:
Die Einführung in die Simulation sowie die Begleitung der Teilnehmer durch die Szenarien müssen professionell, empathisch und klar erfolgen. Eine gute Moderation nimmt die Spannung, schafft Vertrauen und aktiviert den inneren Dialog der Teilnehmer. Sie ist damit nicht nur ein operatives Element, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor der gesamten Maßnahme.
Zeitliche Taktung und organisatorische Durchführung:
Die Durchführung sollte modular, flexibel und in kleinen Gruppen erfolgen. Hierbei haben sich kurze Durchläufe mit anschließender informeller Reflexion bewährt. Die Terminierung ist so zu gestalten, dass auch operative Bereiche partizipieren können, ohne die betrieblichen Abläufe zu stören.
Teilnehmerfeedback und Wirksamkeitserhebung:
Im Anschluss an die Teilnahme sollte ein standardisierter, niedrigschwelliger Feedbackprozess implementiert werden. Ziel ist die qualitative und quantitative Erfassung der wahrgenommenen Relevanz, der Verständlichkeit der Inhalte sowie der emotionalen Resonanz. Dies kann in Form einer Kurzevaluation (analog/digital) mit drei bis fünf Fragen erfolgen. Interne Nachbereitung: Im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist eine strukturierte interne Nachbereitung (Rekapitulation) mit dem Awareness-Team durchzuführen. Dabei werden alle relevanten Parameter kritisch reflektiert: Ablauf, Zielerreichung, Reaktionen, Verbesserungspotenzial. Angestrebt wird, durch Lessons Learned eine optimierte Durchführung bei zukünftigen Kampagnen zu ermöglichen.
Wissensverstetigung und organisationale Verankerung:
Die nachhaltige Wirkung einer Awareness-Kampagne entfaltet sich dann, wenn ihre Inhalte über das einmalige Ereignis hinausgetragen werden. Dies geschieht durch ergänzende Kommunikation im Intranet, in Mitarbeiter-Newslettern oder in Briefings. Ziel ist eine langfristige Verankerung der Kernbotschaften in der Unternehmenskultur. Gute Geschichten bleiben. Wir erzählen sie weiter, lassen sie ins Intranet wandern, in die Kaffeeküche, manchmal sogar in die Chefetage. Wenn sich etwas herumspricht, dann nicht nur, weil es gut war, sondern weil es berührt hat.

Die rot markierten Hinweise und Dokumente sind Teil des interaktiven Cybersicherheitstrainings, bei dem die Teilnehmer die versteckten Verstöße identifizieren müssen.
Fazit
Ein Cyber Exit Room ist mehr als ein Spiel – es ist ein wirksames Instrument für gelebte Informationssicherheit. Wer Awareness nicht nur erklärt, sondern erlebbar macht, kann Verhaltensänderung auf eine Weise anstoßen, die nachhaltig wirkt. Entscheidend ist nicht das Budget, sondern die Haltung: Sicherheit beginnt mit dem Menschen – und lebt vom Dialog, der Beteiligung und dem gemeinsamen Verstehen.
Eine gute Kampagne startet mit klaren Zielen: Soll Verhalten verändert, ein Risiko adressiert oder das Sicherheitsbewusstsein gestärkt werden? Die Themenwahl orientiert sich an Alltagsrisiken – Clear Desk, Passwortsicherheit, physischer Zugangsschutz. Entscheidend ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit HR, Datenschutz, Kommunikation, Facility-Management und der Geschäftsleitung. Die Umsetzung erfolgt idealerweise in realen Arbeitsräumen, didaktisch klug aufgebaut, visuell einprägsam und moderiert. Kurze Feedbackprozesse helfen bei der Wirksamkeitseinschätzung. Flankierende Kommunikation sorgt für Nachhaltigkeit – im Intranet, im Team, in der Kaffeeküche.
Awareness muss nicht belehrend sein. Sie darf spielerisch sein. Und sie darf sogar Spaß machen. Vor allem aber sollte sie bewirken, dass etwas hängen bleibt. Denn Sicherheit beginnt im Kopf – und im besten Fall mit einem Lächeln.

Erfan Koza ist promovierter Informationssicherheitsexperte, Sicherheitsforscher,
Hochschuldozent und Autor des Buches „Social Engineering und Human Hacking“.
Newsletter Abonnieren
Abonnieren Sie jetzt IT-SICHERHEIT News und erhalten Sie alle 14 Tage aktuelle News, Fachbeiträge, exklusive Einladungen zu kostenlosen Webinaren und hilfreiche Downloads.